
Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg
2022
Die virtuelle Ausstellung präsentiert Friedensreportagen und Porträts von Menschen aus Konfliktregionen weltweit, die sich mit kreativen, gewaltfreien Methoden für Frieden, Versöhnung und zivilgesellschaftliche Konfliktbearbeitung einsetzen. Besucher:innen können die Ausstellung online in einem geführtem Rundgang oder selbstständig erkunden und so Einblicke in Projekte aus etwa 30 Ländern gewinnen, die zeigen, wie Frieden praktisch möglich wird und welche Rolle dabei zum Beispiel Jugendliche und Frauen spielen. Ergänzend gibt es friedenspädagogische Arbeitsmaterialien und Workshops für Unterricht und Bildungsarbeit, um die Themen vertieft zu bearbeiten.
Mehr erfahren: Virtuelle Ausstellung „Peace Counts – Frieden machen“
Klett Kinderbuch
2009
Ein Land ohne Mauer – da ist keiner sauer!Diesen Spruch malt Fritzi auf ein Plakat,das ihre Mutter zur Demo mitnehmen soll.Fritzi darf leider nicht mit. Für Kinderist es zu gefährlich bei den LeipzigerMontagsdemonstrationen, finden dieErwachsenen. Aber Fritzi lässt nicht locker …Der Herbst 1989 aus Kinderperspektive.Auf der Website des Verlags – aufrufbar über den Button "Externe Quelle" – findet sich pädagogisches Begleitmaterial zu dem Buch für den Unterricht. Hier ist der Beitrag zu dem Film Fritzi – Eine Wendewundergeschichte der Balance Gilm GmbH.
Mehr erfahren: Fritzi war dabei. Eine Wendewundergeschichte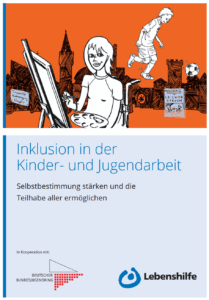
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Deutscher Bundesjugendring e.V.
2021
Kinder- und Jugendarbeit ist nur dann wirklich inklusiv, wenn Angebote für Freizeit, Gruppen und Jugendorganisationen allen jungen Menschen offenstehen — unabhängig davon, ob sie eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben. Soziale Teilhabe für alle kann ermöglicht werden, wenn Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer Interessen mitentscheiden und ihre Freizeit aktiv mitgestalten können. Zwar gibt es bereits vereinzelt gute Praxisbeispiele, doch viele Barrieren bestehen weiterhin – etwa bauliche Hindernisse, mangelnde barrierefreie Informationen oder fehlende Assistenz für Jugendliche mit Behinderung. Um echte Teilhabe zu erreichen, braucht es eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Behindertenhilfe, mehr Ressourcen und Sensibilisierung von pädagogischen Fachkräften. Die Broschüre bietet deshalb neben einer Standortbestimmung auch Handlungsempfehlungen, praktische Hinweise und Finanzierungsmöglichkeiten für eine inklusive Umsetzung.
Mehr erfahren: Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit. Selbstbestimmung stärken und die Teilhabe aller ermöglichen
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs)
2025
Seit 1998 wird die JIM-Studie zur Mediennutzung von 12- bis 19-Jährigen jährlich durchgeführt. Ziel der Studie ist es, ein aktuelles Bild der Mediennutzung junger Menschen in Deutschland zu erhalten. Für die Erhebung werden etwa 1200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland mit einer Kombination von Telefon- und Online-Interviews befragt.Die gewonnenen Daten sollen in Strategien für neue Konzepte in den Bereichen Bildung, Kultur und Arbeit einfließen. JIM-Studie 2025Die JIM-Studie 2025 zeigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) hat bei Jugendlichen massiv an Bedeutung gewonnenhat: 91 % nutzen mindestens ein KI-Tool, vor allem zum Lernen (74 %) und um Informationen zu finden (70 %). Mehr als die Hälfte der Befragten vertraut den durch KI gelieferten Informationen. Gleichzeitig bleibt das Smartphone zentral im Alltag: Jugendliche verbringen im Durchschnitt fast vier Stunden pro Tag am Bildschirm. Eine Regulierung der Nutzungszeit fällt den meisten Befragten schwer. Fast ein Drittel der Jugendlichen berichtet, morgens müde zu sein, weil sie bis spät nachts am Handy waren.Hier können JIM-Studien aus den vergangenen Jahren aufgerufen werden.
Mehr erfahren: JIM-Studie 2025. Jugend, Information, Medien
Centre for Children’s Rights, Queen’s University Belfast, Terre des hommes
2024
The report was developed in close cooperation with Ukrainian children to ensure that young people’s voices and experiences were directly reflected in the findings. The report highlights how the ongoing war has gravely affected children’s rights, documenting large-scale violations such as attacks on schools and hospitals, mass displacement, family separation, and the unlawful deportation of children to Russian-occupied areas. Central findings show that while Ukraine has taken steps to align with international child rights standards, many children still lack access to education, health care, and psychosocial support, and face systemic obstacles in justice and protection services. The report calls for urgent reforms, stronger national child protection systems, and sustained international cooperation to guarantee that all children in Ukraine can live safely, learn, and recover from the impacts of war. The report in Ukranian language can be found here. Beitrag in deutscher Sprache: Der Bericht wurde in enger Zusammenarbeit mit ukrainischen Kindern erstellt, um die Stimmen und Erfahrungen junger Menschen in den Bericht einzubringen. Der Bericht hebt hervor, wie der anhaltende Krieg die Rechte der Kinder massiv verletzt, und dokumentiert Verstöße wie Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, Massenvertreibungen, Familientrennungen und die rechtswidrige Deportation von Kindern in von Russland besetzte Gebiete. Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass die Ukraine zwar Schritte unternommen hat, um sich an internationale Kinderrechtsstandards anzupassen, viele Kinder jedoch nach wie vor keinen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und psychosozialer Unterstützung haben und mit systemischen Hindernissen bei der Justiz und dem Kinderschutz konfrontiert sind. Der Bericht fordert dringende Reformen, stärkere nationale Kinderschutzsysteme und eine nachhaltige internationale Zusammenarbeit, um zu gewährleisten, dass alle Kinder in der Ukraine sicher leben, lernen und sich von den Auswirkungen des Krieges erholen können. Der Bericht in ukrainischer Sprache ist hier zu finden.
Mehr erfahren: Report on the rights of Ukrainian children affected by the full-scale invasion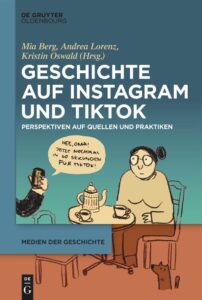
Mia Berg, Andrea Lorenz und Kristin Oswald; Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0
2025
Die Autor:innen des Bandes untersuchen, wie Geschichte in Sozialen Medien wie Instagram und TikTok vermittelt, dargestellt und rezipiert wird. Aus interdisziplinärer Perspektive – mit Beiträgen aus Geschichtswissenschaft, Medienwissenschaft und Praxis – analysiert der Band, wie plattformspezifische Mechanismen, Algorithmen und Nutzungsweisen historische Bedeutungen prägen. Dabei werden Themen wie Archivierung, Erinnerungskultur (z. B. Holocaust, Migration, kulturelles Erbe) und partizipative Geschichtspraxis behandelt. Das Buch zeigt, dass Soziale Medien nicht nur Kommunikationsräume sind, sondern aktive Orte der historischen Sinnstiftung und Aushandlung im 21. Jahrhundert. Das gesamte Buch kann kostenfrei als PDF über die externe Quelle abgerufen werden. Text in English language: The authors of this volume examine how history is communicated, represented, and received on social media platforms such as Instagram and TikTok. Taking an interdisciplinary approach—with contributions from the fields of history, media studies, and practice—the volume analyzes how platform-specific mechanisms, algorithms, and modes of use shape historical interpretations. Topics such as archiving, memory culture (e.g., the Holocaust, migration, cultural heritage), and participatory historical practice are addressed. The book shows that social media are not only spaces for communication, but also active sites of historical meaning-making and negotiation in the 21st century. The entire book can be downloaded free of charge as a PDF from the external source.
Mehr erfahren: Geschichte auf Instagram und TikTok. Perspektiven auf Quellen und Praktiken
Das Progressive Zentrum, Bertelsmann Stiftung, Stiftung Mercator
2025
In der Studie wurde untersucht, wie junge Menschen über TikTok und Instagram mit demokratischen Inhalten erreicht werden können. Dafür wurden zehntausende Kurzvideos im Zeitraum von Juni bis Dezember 2024 analysiert, eine repräsentative Befragung durchgeführt und Fokusgruppen mit jungen Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren einbezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass provokative und populistische Inhalte oft eine deutlich höhere Reichweite erzielen als Beiträge demokratischer Akteur:innen. Damit demokratische Botschaften junge Menschen besser erreichen, empfehlen die Autor:innen der Studie, Inhalte stärker an den Stil und die Sprache der Plattformen anzupassen – etwa durch persönliche Ansprache, verständliche Sprache und visuell ansprechende Formate.
Mehr erfahren: Studie: How to Sell Democracy Online (Fast)
Michael Krennerich (Leitung), Christina Binder, Tessa Debus, Elisabeth Holzleithner und Weitere
2021
In dem Artikel erklärt Crenshaw, wie Intersektionalität – das Zusammenspiel mehrerer Unterdrückungs- und Diskriminierungsachsen wie Geschlecht, Rassismus, Klasse, Ethnie oder Religion – unabdingbar ist für ein vollständiges Verständnis und den Schutz von Menschenrechten. In vielen Fällen werden Menschen nicht einfach allein „wegen ihres Geschlechts“ oder „wegen ihrer Herkunft“ benachteiligt, sondern genau an der Schnittstelle mehrerer Identitäten, wodurch spezifische, oft übersehene Vulnerabilitäten entstehen. Um diese wirksam anzugehen, fordert die Autorin unter anderem eine kontextbezogene Analyse, bessere Datenerhebung, methodische Ansätze, die bewusst nach mehreren Dimensionen der Unterdrückung suchen, sowie Institutionen, die diese Schnittstellen bei Gesetzgebung, Berichterstattung und Schutzmechanismen systematisch berücksichtigen. Der Artikel ist unter dem angegebenen Link via Open Access abrufbar. Der Artikel ist erschienen in: Zeitschrift für Menschenrechte, Jahrgang 15, 2021, Nr.1, S. 142-166.
Mehr erfahren: Das Konzept der Intersektionalität und seine Bedeutung für die Menschenrechte
Unicef Österreich
2024
Das Unterrichtsmaterial richtet sich an Schüler:innen von 8 bis 14 Jahren und vermittelt die UN-Kinderrechtskonvention auf interaktive Weise. Es bietet Stundenpläne, Arbeitsblätter und Methoden, um Kinderrechte und ihren Zusammenhang mit den Globalen Entwicklungszielen zu verstehen, über Fortschritte und Herausforderungen zu diskutieren und eigene Ideen für eine kinderfreundliche Zukunft zu entwickeln. Konkret werden die Kinderrechte auf Beteiligung (Artikel 12), faire Behandlung (Artikel 2) Bildung (28) Leben und gesunde Entwicklung (Artikel 6 und Artikel 24) sowie das Recht auf Spiel und Freizeit (Artikel 31) vermittelt. Kreative Methoden fördern dabei Teilhabe, Reflexion und gemeinschaftliches Lernen im Unterricht.
Mehr erfahren: Die Kindheit von morgen gestalten: Für jedes Kind, jedes Recht
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
2025
In dem Bilderbuch wird mit Wimmelbildern und leicht verständlichen Texten erklärt, welche Rechte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien laut dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) haben. Auf 20 Doppelseiten tauchen die Leser:innen in Alltagssituationen wie Kita, Jugendamt, Betreuung durch eine Vormundin oder eine Demo für Kinderrechte ein. Das Bilderbuch wurde von jungen Menschen aus Selbstvertretungen entwickelt und aktiv mitgestaltet. Komplexes Sozialrecht wird in dem Buch verständlich und kindgerecht vermittelt, damit alle ihre Rechte kennen und wahrnehmen können.
Mehr erfahren: Das SGB VIII in Bildern© 2025 National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V.