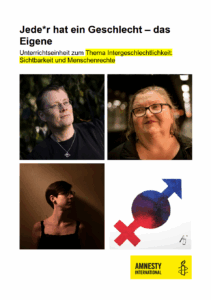
Themenkoordinationsgruppe Queeramnesty Amnesty International Deutschland e. V.
2022
Die Unterrichtseinheit behandelt Intergeschlechtlichkeit als Menschenrechtsthema und richtet sich an Schüler:innen ab der 8. Klasse. Sie soll Aufklärung über intergeschlechtliche Menschen, das Sichtbarmachen von Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen leisten und Intergeschlechtlichkeit als Normalität vermitteln. Im Mittelpunkt stehen u. a. die biologische Vielfalt von Geschlecht, die Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen und die Frage, wie gesellschaftliche Normen und medizinisch nicht notwendige Eingriffe zu Menschenrechtsverletzungen führen können. Die Einheit kombiniert Videos, Gruppenarbeiten und persönliche Porträts zur Diskussion und Reflexion im Unterricht.
Mehr erfahren: Jede*r hat ein Geschlecht – das Eigene. Unterrichtseinheit zum Thema Intergeschlechtlichkeit: Sichtbarkeit und Menschenrechte
Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut; Lizenz: CC BY-NC-ND
2022
Auf zwischentöne werden multimedial aufbereitete Unterrichtsmodule für die Sekundarstufen I und II in Fächern wie Politik, Geschichte, Ethik/Religion und Geografie kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Module gliedern sich in drei Themenfelder: Identitäten – Wer ist „wir“?, Deutsche Geschichte und globale Verflechtungen sowie Religionen & Weltanschauungen. Die Unterrichtsmodule unterstützen Lehrkräfte dabei, multiperspektivische, lebensnahe Unterrichtseinheiten zu gestalten, die Schüler:innen zu kritischer Reflexion über Diversität, Zugehörigkeit und gesellschaftliche Zusammenhänge anregen.Module zu Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung, unterschiedlichen Diskriminierungsformen und Rollenbildern finden sich zum Beispiel unter dem Thema Identitäten. Das Themenfeld Deutsche Geschichte und globale Verflechtungen enthält beispielsweise Unterrichtsmodule wie Deutsch-polnische Migrationsgeschichten, Postkolonial Erinnern und Extremismus. Im Themenfeld Religionen & Weltanschauungen finden sich u.a. Module zum Umgang mit Bildern im Islam, zur Auseinandersetzung mit radikal-religiösen Strömungen und der Vielfalt religiöser Traditionen.
Mehr erfahren: zwischentöne. Materialien für Vielfalt im Klassenzimmer
Jugendnetzwerk Lambda e.V.
2025
lambda space ist Deutschlands erstes digitales queeres Jugendzentrum, das jungen Menschen zwischen 14 und 26 Jahren einen sicheren, geschützten Online-Raum bietet, um sich auszutauschen, Gemeinschaft zu erleben und Gleichgesinnte kennenzulernen – rund um die Uhr und von überall aus, über iOS, Android oder Web erreichbar. Das Angebot richtet sich an queere junge Menschen. Queer heißt zum Beispiel lesbisch, bisexuell, trans* oder schwul zu sein. Die Plattform möchte die Atmosphäre eines realen Jugendzentrums in den digitalen Raum übertragen, legt Wert auf Sicherheit und Schutz und ist ein gemeinnütziges, von der Community mitgestaltetes Projekt des Jugendnetzwerks Lambda e.V., bei dem Mitglieder auch Mitspracherechte haben.
Mehr erfahren: lambda space – Dein digitales Jugendzentrum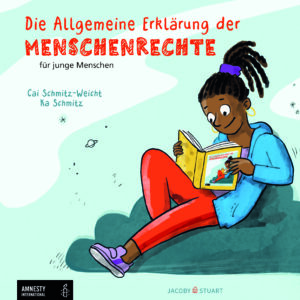
Jacoby Stuart Verlag
2022
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 wird in dem Kindersachbuch kindgerecht dargestellt und in eine leicht verständliche Sprache übertragen. In Zusammenarbeit mit Amnesty International werden die 30 Artikel der Erklärung einzeln vorgestellt und erklärt – etwa das Recht auf Gleichheit, auf Eigentum, auf Bildung und Freizeit sowie auf Privatsphäre. Die kindgerechte Darstellung zeigt, dass Menschenrechte auch für Kinder gelten, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Aussehen oder Lebensumständen, und macht klar, wie diese Rechte im Alltag wirken und warum sie wichtig sind.
Mehr erfahren: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte für junge Menschen
Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg
2022
Die virtuelle Ausstellung präsentiert Friedensreportagen und Porträts von Menschen aus Konfliktregionen weltweit, die sich mit kreativen, gewaltfreien Methoden für Frieden, Versöhnung und zivilgesellschaftliche Konfliktbearbeitung einsetzen. Besucher:innen können die Ausstellung online in einem geführtem Rundgang oder selbstständig erkunden und so Einblicke in Projekte aus etwa 30 Ländern gewinnen, die zeigen, wie Frieden praktisch möglich wird und welche Rolle dabei zum Beispiel Jugendliche und Frauen spielen. Ergänzend gibt es friedenspädagogische Arbeitsmaterialien und Workshops für Unterricht und Bildungsarbeit, um die Themen vertieft zu bearbeiten.
Mehr erfahren: Virtuelle Ausstellung „Peace Counts – Frieden machen“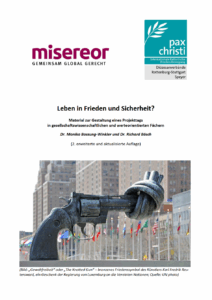
Misereor e.V.
2024
Das Unterrichtsmaterial richtet sich an Schüler:innen der Klassen 9–10 und dient der Friedens‑ und Sicherheitsbildung im globalen Kontext. Es ist als Projekttag oder modularer Unterricht aufgebaut und gliedert sich in drei Hauptteile: Was bedeutet Frieden?, Konfliktsituationen verstehen und Utopien für Sicherheit neu denken.
Mehr erfahren: Leben in Frieden und Sicherheit? Material zur Gestaltung eines Projekttags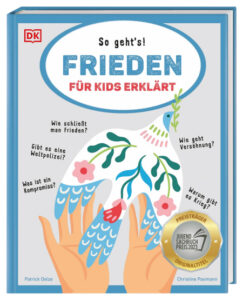
DK Verlag – Kids
2023
Ein kindgerecht aufbereitetes Sachbuch für Kinder ab etwa 10 Jahren, in dem zentrale Fragen zu Konflikten, Krieg und Frieden verständlich beantwortet werden. Anhand von Alltagsbeispielen aus dem Leben einer Familie und Illustrationen werden Begriffe wie Streit, Versöhnung, Diplomatie und Frieden erklärt, und es wird gezeigt, wie Konflikte sowohl im persönlichen Umfeld als auch zwischen Staaten gelöst werden können. Das Buch vermittelt, was Frieden bedeutet, warum Krieg entsteht und was jede:r Einzelne für ein friedliches Zusammenleben tun kann, und macht so komplexe politische Themen für junge Leser:innen zugänglich.
Mehr erfahren: Frieden für Kids erklärt
Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg
2023
Das Lern- und Aktionsheft unterstützt junge Menschen, ihr eigenes Engagement für Frieden zu entdecken und umzusetzen. Es enthält Aktionsideen, Wissenseinheiten zu Friedens‑ und Konfliktbegriffen und Schritt‑für‑Schritt‑ Anleitungen für eigene Friedensaktionen.
Mehr erfahren: Peace Guide. 26 Friedensaktionen für Schüler:innen
Beltz Juventa
2025
Die Autorinnen verstehen Soziale Arbeit als Friedensprofession mit besonderem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Sie plädieren für eine konsequente Verankerung von Kinder- und Menschenrechtsbildung in der Praxis, Ausbildung und in Institutionen der Sozialen Arbeit. Frieden wird nicht nur als Abwesenheit von Krieg verstanden, sondern als gerechtes, inklusives und gewaltfreies Miteinander – lokal und global, heute und transgenerational.
Mehr erfahren: Niemals Gewalt. Kinder- und Menschenrechtsbildung für transgenerationale Friedensförderung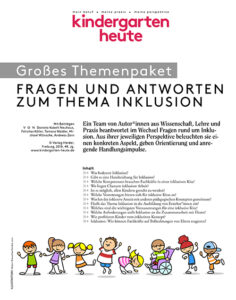
kindergarten heute
2018
Ein Team von Autor/-innen aus Wissenschaft, Lehre und Praxis beantwortet im Wechsel brisante Fragen rund um Inklusion. Aus ihrer jeweiligen Perspektive beleuchten sie einen konkreten Aspekt, geben Orientierung und anregende Handlungsimpulse.
Mehr erfahren: Fragen und Antworten zum Thema Inklusion© 2025 National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.